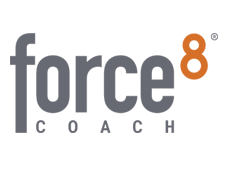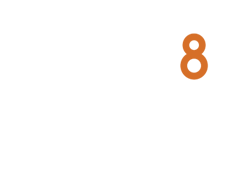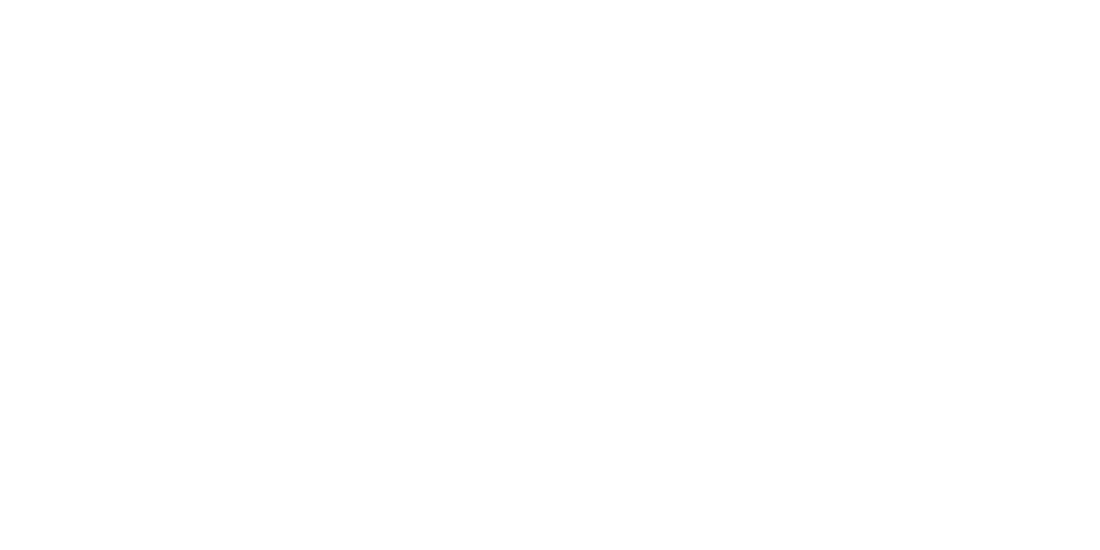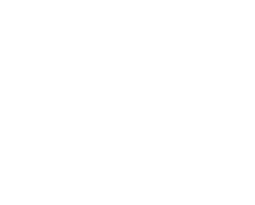NZZ Swiss Ski Command Center
Swiss Ski nutzt im neuen Command Center die Wissenschaft, um Athleten noch schneller zu machen – dabei zählt jede Sekunde
Remo Geisser, NZZ
Ende Januar, Ski-Weltcup in Schladming: Thomas Tumler steht im Starthaus, ein Piepston kündigt an, dass das Rennen gleich losgeht. Als sich der Athlet abstösst, brandet am Pistenrand Jubel auf. Hunderte Kilometer entfernt greifen Björn Bruhin und Luca von Siebenthal in einem Raum voller Bildschirme zur Computermaus. Im sogenannten Command Center am Swiss-Ski-Sitz in Worblaufen bei Bern erfassen die beiden Daten, die sie wenig später per Whatsapp nach Schladming schicken werden.
Sie tragen ihren eigenen Wettkampf gegen die Zeit aus und wirken trotzdem völlig entspannt, kommunizieren in kurzen Sätzen. Luca von Siebenthal verfolgt auf dem Bildschirm direkt vor sich einen Stream, den der TV-Sender SRF zur Verfügung stellt. Auf diesem Kanal treffen die Bilder etwas schneller ein als bei den Fernsehkonsumenten.
Steckbrief des Weltcup-Slaloms
Auch der Swiss-Ski-Coach am Start in Schladming empfängt diesen Stream auf einem Tablet. So kann Loïc Meillard, der mit der Nummer 5 ins Rennen gehen wird, die Fahrt von Tumler einen Tick früher verfolgen, als wenn er das übliche TV-Signal zur Verfügung hätte. Im Rennmodus zählt jede Sekunde. Das gilt auch im Command Center. Sobald Tumler im Ziel ist, fängt von Siebenthal an, den Lauf des Fahrers zu vermessen.
Luca von Siebenthal setzt im TV-Bild bei jedem Tor einen Punkt und misst die Zeit, die der Athlet von einer Stange zur nächsten braucht. Im Riesenslalom seien das durchschnittlich 1,3 Sekunden, wirft Bruhin ein, der daneben an einem anderen Bildschirm arbeitet. Im Slalom dauert es durchschnittlich nicht einmal 0,9 Sekunden von einem Tor zum nächsten.
Der Ski-Weltverband FIS stellt den Teams ausserdem für jedes Rennen einen Datensatz zur Verfügung, in dem unter anderem der Abstand von Tor zu Tor, der seitliche Versatz und das Gefälle festgehalten sind. Das und die Zeitintervalle von Tor zu Tor ergeben eine Art Steckbrief der Weltcup-Slaloms.
Dieser hilft den Trainern bis hinunter in den Nachwuchs, Trainingsläufe auszuflaggen, die möglichst nahe an der Realität des Elitesports sind. Die Zeiten, als die Stangen nach Gefühl in den Schnee gebohrt wurden, sind längst vorbei: Heute wird auch im Training jedes Tor vermessen. Dennoch gibt es persönliche Vorlieben. Es wäre möglich, für jeden Kurssetzer im Weltcup eine Art Schablone der typischen Läufe zu erstellen. Doch das ist noch Zukunftsmusik.
Björn Bruhin leitet die Forschung bei Swiss Ski, und das Command Center ist nur eines seiner Projekte. Im vergangenen Jahr wurde das Konzept in einer Projektphase getestet, auf diese Saison hin hat Swiss Ski den Computerraum in Worblaufen installiert. An grossen Rennen gibt es auch mobile Einheiten, an den WM in Saalbach arbeiten die Wissenschafter wie schon im Januar an den Lauberhornrennen in einem Hotelzimmer. Das Command Center in Worblaufen ist während achtzig Tagen in Betrieb, neben den Alpinen werden auch die Freestyler und die Nordischen mit Daten versorgt.
An den Abfahrtsstrecken stellen die Teams an verschiedenen Positionen Wetterstationen auf. Zudem vermisst Swiss Ski mit GPS die gesamte Piste. Bruhin und seine Kollegen suchen eine Position am Gegenhang, von der aus sie möglichst die ganze Strecke filmen können. Dann legen sie Abschnitte fest, in denen die Fahrer miteinander verglichen werden. Dabei hilft auch ein GPS-Tracker, den sich die Athleten vor dem Start unter den Anzug schieben.
In Speedrennen wird auch immer festgehalten, welcher Athlet mit welchem Anzug unterwegs ist. Ihnen stehen Kombis mit verschiedenen Stoffen und Schnitten zur Verfügung. Ziel ist es, herauszufinden, was bei welchen Bedingungen schnell ist, denn im Windkanal lässt sich die Natur nicht vollständig simulieren. Ausserdem will Swiss Ski wissen, wie oft ein Anzug gefahren wird. Bei den Topathleten gilt die Regel, dass ein Anzug einmal in einer Abfahrt und einmal in einem Super-G getragen wird. Danach genügt er noch fürs Training, oder er wird an untere Kader weitergereicht.
Vergleich mit schnellstem Fahrer
Im Riesenslalom von Schladming sind die ersten 15 Fahrer im Ziel, im Command Center wird schnell und konzentriert gearbeitet. Luca von Siebenthal misst die Zeiten von Tor zu Tor; Bruhin schneidet Videos zusammen. Ziel ist es, dass die Trainer alle Analysen zur Verfügung haben, wenn die Nummer 30 den Lauf beendet hat.
Verglichen werden alle mit dem schnellsten Fahrer des ersten Durchgangs, in diesem Fall Loïc Meillard. Seine Zeit bildet in einer Grafik eine gerade Linie, die anderen Kurven verlaufen im Zickzack. So erfassen die Trainer auf einen Blick, wo Zeit gewonnen oder verloren wurde. Nach seinem Ausscheiden beim Saisonstart in Sölden hatte Marco Odermatt diese Grafik angeschaut, ehe er mit den Journalisten redete. Deshalb konnte er sich gelassen geben: «Ich weiss, dass die Form stimmt. An dem Tor, an dem ich ausschied, hatte ich 0,7 Sekunden Vorsprung.»
In Schladming gelingt dem 27-Jährigen der erste Durchgang nicht nach Wunsch. Luca von Siebenthal setzt seine Messpunkte und sagt: «Die ‹Banane› ist Odi ganz anders gefahren.» Bruhin schneidet die dazugehörigen Bilder: «Er hat viel mehr Weg gemacht.» Die Videos, die Bruhin nach Schladming schickt, zeigen zwei Athleten nebeneinander in der gleichen Passage. Oder die Fahrer werden in einem Bild übereinandergelegt. Letzteres ist in den technischen Disziplinen eher eine Zugabe, in Speed-Rennen aber sehr hilfreich, weil dort die Linienwahl entscheidend ist.
Auf dem Smartphone greifbar
Mit den Daten und Bildern kann man endlos spielen. Bruhin sagt, in den vergangenen Jahren habe man den Trainern mehr Material zur Verfügung gestellt als in der laufenden Saison. Feedbacks zeigten, dass mehr nicht immer besser ist. Coach und Athlet können zwischen zwei Läufen nur eine begrenzte Anzahl Inputs umsetzen. Deshalb gibt es heute ein Bestellformular, auf dem die Trainer angeben, was sie wollen. Dazu gehören Daten aus dem zweiten Durchgang, die Anhaltspunkte für das Training liefern.
Die Coachs können ihre Positionen am Streckenrand während des Rennens nicht verlassen. Früher gab es Leute, die ihre Speicherkarten einsammelten, um dann im Zielraum Videos zu produzieren. Im Command Center geht das viel schneller. Die Grafiken und die Videos werden in einen Chat gestellt, so dass sie auf dem Smartphone sofort greifbar sind. Auch deshalb ist es wichtig, dass keine Datenflut entsteht.
Erkenntnisse, die während der Saison gesammelt werden, können auch in der Ausbildung von Trainern eingesetzt werden. Je genauer die Techniker wissen, welche Torabstände, Figuren und Rhythmen auf dem höchsten Niveau üblich sind, desto besser können junge Athletinnen und Athleten an dieses Niveau herangeführt werden. Es geht nicht nur darum, dass Odermatt heute schnell ist – schon heute werden seine Nachfolger aufgebaut.
Aus dem NZZ E-Paper vom 15.02.2025